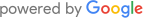Akustikwissen kompakt von A-Z
Absorberklassen – für jedes Raumkonzept die passende Lösung
Akustikelemente werden in die Absorberklassen A bis E eingeteilt. Grundlage ist der bewertete Schallabsorptionsgrad (αw). Diese Klassifizierung ermöglicht es, die Wirkung der Materialien klar messbar zu vergleichen:
-
-
A = sehr hoch absorbierend, αw 0,90 – 1,00
-
B = sehr hoch absorbierend, αw 0,80 – 0,85
-
C = hoch absorbierend, αw 0,60 – 0,75
-
D = ausreichend absorbierend, αw 0,30 – 0,55
-
E = gering absorbierend, αw 0,15 – 0,25
-
Die Wahl der passenden Klasse richtet sich nach den akustischen Anforderungen eines Raumes. Materialien verschiedener Absorberklassen ergänzen die vorhandene Schallabsorption gezielt.
Absorptionsgrad
Der Absorptionsgrad α – auch Alpha-Wert genannt – gibt an, welcher Anteil des einfallenden Schalls von einer Oberfläche aufgenommen und nicht reflektiert wird.
-
-
α = 0 → keine Absorption, 100 % Reflexion
-
α = 0,5 → 50 % Absorption, 50 % Reflexion
-
α = 1 → vollständige Absorption, keine Reflexion (z. B. offenes Fenster oder „schalltoter“ Raum)
-
In der Praxis liegen die Werte gängiger Schallschlucksysteme meist zwischen 0,2 und 0,8. Der tatsächliche Wert hängt von Material, Oberflächenstruktur und Frequenz ab.
Für die Raumakustik ist das Zusammenspiel von absorbierter und reflektierter Schallenergie entscheidend für die Klangwahrnehmung.
Unter praxisnahen Bedingungen können auch α-Werte größer als 1 angegeben werden. Das berücksichtigt, dass die wirksame Fläche eines Absorbers etwas größer sein kann als seine reine geometrische Fläche.
Zusätzlich unterscheidet man zwischen verschiedenen Alpha-Werten:
-
-
αp – gemessen bei senkrechtem Schalleinfall (P = Perpendicular)
-
αs – gemessen bei diffusem Schalleinfall (S = Sound field)
-
αw – bewerteter Schallabsorptionsgrad nach Norm (W = Weighted)
-
Akustik – die Wissenschaft vom Klang
Die Akustik (vom griechischen akoyein = „hören“) ist die Lehre vom Schall und seiner Ausbreitung. Sie beschäftigt sich mit:
-
-
der Entstehung und Erzeugung von Schall
-
seiner Ausbreitung und Beeinflussung
-
der Wahrnehmung durch das Gehör
-
den Wirkungen auf Menschen und Tiere
-
Als interdisziplinäres Fachgebiet verbindet die Akustik Erkenntnisse aus Physik, Psychologie, Nachrichtentechnik und Materialwissenschaft.
Wichtige Anwendungen sind:
-
-
Lärmminderung und Lärmschutz
-
Raum- und Bauakustik für angenehmen Klang
-
Übertragung akustischer Informationen
-
Medizinische und technische Nutzung von Schall (z. B. Diagnoseverfahren)
-
Kurz gesagt: Akustik macht hörbar, wie Räume klingen – und wie wir Klang bewusst gestalten können.
Akustikbilder – Design trifft Raumakustik
Akustikbilder verbinden Funktion und Gestaltung in einzigartiger Weise:
Sie bestehen aus schallabsorbierenden Materialien, die störenden Nachhall reduzieren und so für eine angenehme Raumakustik sorgen.
Dank frei wählbarer Motive und diverser Größen entstehen individuelle Kunstwerke, die sich harmonisch in jede Raumarchitektur einfügen – stilvoll, unauffällig und akustisch wirksam zugleich.
Akustischer Wirkungsgrad
Der akustische Wirkungsgrad (engl. acoustic efficiency) beschreibt bei Schallquellen das Verhältnis zwischen der aufgenommenen elektrischen oder mechanischen Leistung und der tatsächlich abgestrahlten Schallleistung.
Analog zum allgemeinen Wirkungsgrad wird er mit η (Eta) bezeichnet und kann Werte zwischen 0 und 1 (bzw. 0 bis 100 %) annehmen:
N = Pak / Pel
-
-
Pak = abgegebene akustische Leistung
-
Pel = aufgenommene elektrische oder mechanische Leistung
-
Bei Geräten, deren Zweck nicht die Schallerzeugung ist, spricht man statt vom Wirkungsgrad vom Umsetzungsgrad – etwa bei Maschinengeräuschen, die als unerwünschte Nebenerscheinung auftreten.
Äquivalente Schallabsorptionsfläche
Die äquivalente Schallabsorptionsfläche A beschreibt, wie stark Bauteile, Möbel, Personen oder ganze Räume Schall aufnehmen.
Sie wird berechnet, indem man den Absorptionsgrad α einer Fläche S mit ihrer Größe multipliziert:
A = α ⋅ S [m2]
Das Ergebnis entspricht einer idealen Vergleichsfläche, die den Schall vollständig absorbiert (α = 1).
Für Räume mit mehreren Flächen unterschiedlicher Materialien und Absorptionsgrade gilt:
A = ∑ αi ⋅ Si
So lässt sich jeder reale Raum durch ein Modell mit einer einzigen, vollständig absorbierenden Fläche A darstellen. Man kann sich diese Fläche wie ein „offenes Fenster“ vorstellen, durch das der gesamte absorbierte Schall verschwindet.
Die äquivalente Schallabsorptionsfläche ist eine zentrale Größe zur Beschreibung und Bewertung von raumakustischen Eigenschaften.
Bauakustik – Schutz vor unerwünschtem Schall
Die Bauakustik untersucht, wie sich Schall zwischen Räumen oder zwischen Gebäuden und der Umgebung überträgt. Anders als in der Raumakustik, bei der es um Schallabsorption geht, steht hier die Schalldämmung im Mittelpunkt.
Die zentrale Frage lautet: Wie viel Schall gelangt auf die andere Seite eines Bauteils?
Wichtige Kennzahlen sind:
-
-
Schalldämm-Maß (R)
-
Bewertetes Schalldämm-Maß (Rw)
-
Einheit: Dezibel (dB)
-
Ziel der Bauakustik ist es, durch gezielte Dämmung für Ruhe, Diskretion und Schutz vor Lärm zu sorgen – sei es zwischen Wohnräumen, Büros oder im Kontakt mit der Außenwelt.
Beurteilungspegel – Maß für die Lärmbelastung
Der Beurteilungspegel (oder Tagesexpositionspegel) beschreibt die durchschnittliche Geräuscheinwirkung während eines Arbeitstages. Er wird in dB(A) angegeben und berücksichtigt alle Umgebungsgeräusche am Arbeitsplatz – nicht jedoch die, die man selbst verursacht.
Ein paar wichtige Orientierungswerte:
-
-
55–60 dB(A): normale Gesprächslautstärke in 1 m Entfernung
-
Bereits 58 dB(A) für 4 Stunden oder 61 dB(A) für 2 Stunden entsprechen derselben Lärmbelastung wie ein Tageswert von 55 dB(A)
-
+3 dB(A) verdoppeln die Schallintensität
-
+10 dB(A) werden als doppelt so laut empfunden, –10 dB(A) als halb so laut
-
Der Beurteilungspegel gibt einen wichtigen Überblick über die Lärmbelastung, berücksichtigt aber keine Spitzenpegel und keine subjektive Wahrnehmung. Deshalb sollten Messungen stets durch die Einschätzung der Betroffenen ergänzt werden. Die VDI 2058 fordert dafür, auch Tätigkeit, Geräuschcharakter und persönliche Voraussetzungen einzubeziehen – nur so entsteht ein realistisches Bild der Belastung.
Deckensegel – flexible Akustiklösungen mit Designfreiheit
Deckensegel sind frei hängende, schallabsorbierende Elemente, die die Raumakustik wirkungsvoll verbessern. Durch ihre doppelseitige Wirkfläche nehmen sie Schall nicht nur von unten, sondern auch über Deckenreflexionen von oben auf. Zusätzlich entstehen Beugungseffekte, die die Absorptionsleistung noch verstärken.
Dank ihrer Flexibilität bieten Deckensegel vielfältige Lösungen – auch bei anspruchsvollen architektonischen Vorgaben, z. B. in Gebäuden mit Betonkerntemperierung.
Typische Einsatzbereiche sind offene, lärmintensive Umgebungen wie:
-
-
Großraumbüros
-
Restaurants und Cafés
-
Einkaufszentren
-
Empfangs- und Servicebereiche (z. B. Rezeptionen oder Infopoints)
-
Mit Deckensegeln entstehen komfortable Zonen für Kommunikation, Konzentration und Erholung – selbst in akustisch herausfordernden Räumen.
Dezibel (dB) – die Maßeinheit für Lautstärke
Das Dezibel (dB) ist eine logarithmisch definierte Maßeinheit zur Angabe von Schallpegeln und anderen physikalischen Größen. Es ist ein Zehntel des Bel (B), das nach dem Telefonerfinder Alexander Graham Bell benannt wurde.
Besonders in der Akustik wird dB genutzt, um Schalldruckpegel darzustellen:
-
-
0 dB SPL = Hörgrenze des Menschen (gerade noch wahrnehmbar)
-
140 dB SPL = Schmerzgrenze
-
Da die Dezibel-Skala logarithmisch ist, gilt:
-
-
+3 dB → Verdopplung der Schallintensität
-
+10 dB → subjektiv doppelt so laut
-
Beispiele aus dem Alltag:
-
-
65 dB → normales Gespräch
-
80 dB → Schreien (≈ 30-fache Intensität gegenüber Gespräch)
-
Um das menschliche Hörempfinden besser abzubilden, werden Schallpegel meist als dB(A) angegeben. Diese berücksichtigen, dass sehr tiefe und sehr hohe Töne vom Ohr schwächer wahrgenommen werden.
Diffusität – gleichmäßige Schallverteilung im Raum
Die Diffusität (Schalldiffusität) beschreibt den Grad, mit dem sich reflektierter Schall in einem Raum verteilt – sowohl im Raum selbst als auch über die Zeit. Sie hängt eng mit der subjektiven Wahrnehmung eines diffusen, gleichmäßigen Raumklangs zusammen.
Man unterscheidet:
-
-
Örtliche Diffusität → Gleichmäßigkeit des Schalleinfalls aus allen Richtungen an einem Ort
-
Zeitliche Diffusität → gleichmäßige Verteilung der Reflexionen über die Zeit
-
Eine hohe Diffusität entsteht, wenn Begrenzungsflächen und Gegenstände den Schall nicht spiegelartig, sondern in viele Richtungen reflektieren. Sie ist ein wichtiges Kriterium der Raumakustik und Grundlage vieler Messverfahren.
Wie erreicht man Diffusität?
-
-
Durch gekrümmte Oberflächen und unregelmäßige Strukturen im Raum
-
Durch die Kombination von Reflexion und Absorption
-
In der Audiotechnik auch durch künstliche Halleffekte, um Räume akustisch größer wirken zu lassen
-
Eine ausgewogene Diffusität sorgt für einen angenehmen, natürlichen Klang und ist besonders in Hör- und Aufnahmeräumen entscheidend.
Direktschall – der unmittelbare Klang
Als Direktschall bezeichnet man den Schallanteil, der den Hörer direkt von der Quelle erreicht – ohne Umwege über Reflexionen. Er stammt zum Beispiel von Stimmen, Instrumenten, Lautsprechern oder Maschinen.
Im Zusammenspiel mit reflektierten Schallanteilen (diffusem Schall) entstehen die Begriffe direktes Schallfeld und diffuses Schallfeld, die für die Wahrnehmung und Gestaltung der Raumakustik entscheidend sind.
Echo – der hörbare Widerhall
Ein Echo entsteht, wenn Schallwellen an Flächen reflektiert werden und mit einer so deutlichen Zeitverzögerung zurückkehren, dass sie als eigenständiges Hörereignis wahrgenommen werden.
Das Echo hat die gleiche Tonhöhe wie das Original, klingt aber stets leiser. Unser Gehör nutzt Echos, um Raumgrößen und Entfernungen einzuschätzen.
-
-
Reflexionen < 30 ms → werden noch als Teil des Originaltons empfunden
-
Reflexionen > 30 ms → erscheinen als separates Echo
-
Späte, konzentrierte Reflexionen sorgen dafür, dass wir den typischen „Widerhall-Effekt“ hören.
Flatterecho – störende Mehrfachreflexion
Ein Flatterecho entsteht, wenn ein Schallsignal zwischen stark reflektierenden Flächen mehrfach hin- und hergeworfen wird. Dadurch entsteht eine periodische Folge von Echos, die oft einen tonartigen Charakter haben.
Typische Ursachen:
-
-
große, glatte und parallele Flächen
-
hohe Räume oder Kombinationen von Boden und Decke (z. B. unter Brückenbögen oder gewölbten Decken)
-
Flatterechos werden fast immer als störend empfunden. Sie lassen sich vermeiden durch:
-
-
geometrische Anpassungen der Raumgestaltung
-
den Einsatz von absorbierenden Materialien oder Schallabsorbern auf reflektierenden Flächen
-
Schon wenige gezielte Maßnahmen können den Klang im Raum deutlich verbessern und Flatterechos wirkungsvoll unterdrücken.
Frequenz – die Geschwindigkeit von Schwingungen
Die Frequenz (Formelzeichen f) beschreibt, wie oft sich ein periodischer Vorgang pro Sekunde wiederholt – zum Beispiel bei einer Schwingung oder einem Schallereignis. Sie wird in Hertz (Hz) angegeben:
-
-
1 Hz = 1 Schwingung pro Sekunde
-
1.000 Hz (1 kHz) = 1.000 Schwingungen pro Sekunde
-
In der Akustik gibt die Frequenz die Anzahl der Schalldruckänderungen pro Sekunde an und bestimmt damit die Tonhöhe. Zusammen mit dem Schalldruckpegel (Lautstärke) prägt sie das Klangbild:
-
-
Reine Töne → bestehen aus nur einer Frequenz
-
Klänge und Geräusche → entstehen durch die Überlagerung verschiedener Frequenzen
-
Das menschliche Gehör ist besonders empfindlich im Sprachbereich zwischen 250 und 2.000 Hz. Deshalb sind Störungen in diesem Frequenzbereich besonders unangenehm und beeinträchtigen die Kommunikation stark. Zu sehr hohen und sehr tiefen Frequenzen nimmt die Hörfähigkeit hingegen deutlich ab.
Frequenz und Lautstärke zusammen bestimmen, wie wir Schall wahrnehmen – ob als klaren Ton, angenehmen Klang oder störendes Geräusch.
Frequenzbereich in der Raumakustik
Für die raumakustische Planung sind vor allem die Frequenzen relevant, die das menschliche Gehör wahrnimmt und die sich technisch sinnvoll berücksichtigen lassen.
-
-
Untergrenze: Ab etwa 100 Hz werden tiefe Frequenzen praxisgerecht erfasst
-
Obergrenze: Frequenzen über 5.000 Hz werden bereits stark von der Luft gedämpft und spielen daher kaum eine Rolle in der Planung
-
Daher orientieren sich sowohl die internationalen Normen zur Schallabsorption von Materialien als auch gängige Planungsverfahren am Bereich von 100 Hz bis 5.000 Hz.
Dieser Frequenzbereich bildet die Grundlage, um Räume akustisch so zu gestalten, dass sie für den Menschen verständlich, angenehm und funktional klingen.
Hörbereich des Menschen
Der Hörbereich beschreibt den Frequenz- und Lautstärkebereich, den das menschliche Ohr wahrnehmen kann. Maßangaben dafür sind:
-
-
Frequenz (Hz) → bestimmt die Tonhöhe
-
Schallpegel (dB) → bestimmt die Lautstärke
-
Im Durchschnitt liegt der hörbare Frequenzbereich zwischen 16 Hz (tiefe Töne) und 20.000 Hz (sehr hohe Töne). Individuelle Unterschiede sind jedoch groß: Mit zunehmendem Alter sinkt insbesondere die obere Hörgrenze deutlich ab.
Das bedeutet: Nicht alle Menschen hören gleich – vor allem hohe Töne nehmen ältere Personen oft nicht mehr wahr.
Hörsamkeit – wie Räume klingen
Die Hörsamkeit beschreibt, wie gut ein Raum für Sprache oder Musik geeignet ist – also wie die akustischen Eigenschaften beim Zuhörer wirken. Dabei geht es weniger um rein physikalische Werte, sondern vor allem um die hörpsychologische Wahrnehmung.
Ein gutes Urteil über die Hörsamkeit hängt ab von:
-
-
den Eigenschaften der Schallquelle (z. B. Sprecher, Instrumente, Musikstil)
-
den akustischen Bedingungen im Raum (Reflexion, Nachhall, Lärm)
-
der Position im Raum (Parkett vs. Rang)
-
den individuellen Fähigkeiten und Erfahrungen des Zuhörenden
-
Ziel der Raumakustik ist es, eine gute mittlere Hörsamkeit zu schaffen – sodass Sprache überall verständlich ist und Musik klar und angenehm klingt.
Nach DIN 18041:2004 wird Hörsamkeit definiert als die Eignung eines Raumes für bestimmte Schalldarbietungen.
Lärm – wenn Geräusche zur Belastung werden
Lärm ist jedes unerwünschte oder störende Geräusch. Im Gegensatz zum messbaren Schalldruck ist Lärm immer eine subjektive Empfindung: Was den einen nervt, lässt den anderen kalt – oder wird sogar als angenehm empfunden.
Geräusche entstehen durch Schwingungen, die sich als Schallwellen in der Luft ausbreiten. Ihre Stärke wird als Schalldruckpegel in Dezibel (dB) angegeben. Je lauter ein Geräusch, desto eher wird es als Lärm empfunden.
Auswirkungen von Lärm:
-
-
Beeinträchtigung von Konzentration und Aufmerksamkeit
-
höhere Fehlerquote und geringere Leistungsfähigkeit
-
bei starker oder dauerhafter Belastung: Stress und gesundheitliche Probleme
-
Auch die Nachhallzeit spielt eine Rolle:
-
-
Ist sie zu kurz, leidet die Sprachverständlichkeit.
-
Ist sie zu lang, wirkt der Raum unangenehm hallig.
-
Optimal in Schulen: etwa 0,5 Sekunden.
-
Lärm ist also nicht nur eine Frage der Lautstärke, sondern auch der Raumakustik und individuellen Wahrnehmung.
Lautstärke – wie wir Schall empfinden
Die Lautstärke (oder Lautheit) beschreibt den subjektiv empfundenen Schalldruck. Sie wird in Phon bzw. dB SPL (Dezibel Sound Pressure Level) angegeben.
Das Besondere: Unsere Wahrnehmung hängt stark von der Frequenz ab. Töne mit gleichem Schalldruck können unterschiedlich laut erscheinen – tiefe und sehr hohe Töne nehmen wir leiser wahr als mittlere Frequenzen. Besonders empfindlich ist unser Gehör bei etwa 1.000 Hz, weshalb dieser Wert als Referenz dient.
Zur genaueren Beschreibung nutzt man zusätzlich den Begriff der Lautheit, angegeben in Sone, der auf empirischen Untersuchungen basiert.
Auch die Nachhallzeit im Raum beeinflusst, wie wir Lautstärke empfinden:
-
-
Zu kurz → Sprache klingt abgehackt und schwer verständlich
-
Zu lang → Räume wirken hallig und Geräusche werden als Lärm empfunden
-
Optimal, z. B. in Schulen: ca. 0,5 Sekunden
-
Lautstärke ist also nicht nur eine Frage des Schalldrucks, sondern hängt auch von Frequenz, Raumakustik und subjektiver Wahrnehmung ab.
Lombard-Effekt – lauter sprechen bei Lärm
Der Lombard-Effekt, benannt nach dem französischen Wissenschaftler Étienne Lombard (1868–1920), beschreibt ein alltägliches Phänomen:
Wenn die Umgebungsgeräusche zunehmen, spricht der Mensch automatisch lauter – und oft auch mit einer höheren Stimmlage.
Der Grund: Hohe Frequenzen setzen sich besser gegen Störschall durch als tiefe. So passt sich unsere Stimme unbewusst an, um trotz Lärm verstanden zu werden.
Der Lombard-Effekt erklärt, warum Gespräche in lauten Umgebungen oft anstrengend sind – und warum eine gute Raumakustik entscheidend für Kommunikation und Wohlbefinden ist.
Nachhallzeit – wie lange ein Raum klingt
Die Nachhallzeit (T oder RT60) beschreibt, wie lange ein Schallereignis in einem Raum nachklingt, nachdem die Schallquelle verstummt ist. Technisch wird sie als die Zeit definiert, die der Schalldruckpegel benötigt, um um 60 dB abzufallen – das entspricht einer Reduktion auf ein Tausendstel der ursprünglichen Lautstärke.
Kurze Nachhallzeit:
-
-
Räume wirken „tot“ oder unnatürlich
-
Sprache kann zu leise und undeutlich erscheinen (z. B. in großen Vortragssälen)
-
Lange Nachhallzeit:
-
-
Sprache wird überlagert → schlechte Verständlichkeit
-
Bei Musik verschmelzen Töne, besonders in tiefen Frequenzen → Klang wird unklar
-
Die optimale Nachhallzeit hängt von der Nutzung ab: Für Sprache sind kürzere Zeiten ideal, für Musik darf sie länger sein.
Psychoakustik – wie wir Schall wahrnehmen
Die Psychoakustik ist die Wissenschaft von der Wahrnehmung von Schall durch den Menschen. Sie untersucht, wie wir Töne hören, bewerten und empfinden – und erklärt damit, warum wir manche Klänge als angenehm, andere als störend empfinden.
Wichtige psychoakustische Größen sind:
-
-
Lautheit (Sone) – wie laut ein Schall empfunden wird
-
Rauhigkeit (Asper) – ob ein Klang „kratzig“ oder „weich“ wirkt
-
Schärfe (Acum) – wie spitz oder brillant ein Ton klingt
-
Schwankungsstärke (Vacil) – wie stark Lautstärkeveränderungen wahrgenommen werden
-
Ein zentrales Phänomen ist die Maskierung: Laute Töne überdecken leisere, sodass wir sie gar nicht wahrnehmen. Dieses Prinzip wird in der Audiokompression (z. B. MP3) genutzt, um Daten zu reduzieren – Töne, die wir ohnehin nicht hören könnten, werden einfach weggelassen.
Die Psychoakustik verbindet also Physik und Psychologie – und macht hörbar, wie sehr unsere Wahrnehmung von subjektiven Empfindungen geprägt ist.
Raumakustik – wie Räume klingen
Die Raumakustik beschreibt, wie sich Schall in einem Raum verhält, wenn die Schallquelle im Raum selbst liegt. Ziel ist es, mit passenden Materialien und Oberflächen optimale Hörbedingungen für Sprache und Musik zu schaffen.
Die Schallausbreitung hängt dabei stark von der Frequenz ab:
-
-
Hohe Frequenzen → lassen sich mit dem Modell der geometrischen Akustik erklären: Schall breitet sich strahlenförmig aus und wird an Wänden reflektiert. Ein wichtiges Kriterium ist hier die Nachhallzeit, die bestimmt, wie hallig ein Raum klingt.
-
Tiefe Frequenzen → folgen der wellentheoretischen Akustik: Hier entstehen Raumeigenmoden, also stehende Wellen, die zu stark schwankenden Lautstärken im Raum führen können.
-
Die Grenzfrequenz zwischen beiden Bereichen hängt vom Raumvolumen ab:
-
-
Auto: ca. 400 Hz
-
Wohnzimmer: ca. 180 Hz
-
Konzertsaal: ca. 30 Hz
-
Gute Raumakustik sorgt dafür, dass Sprache klar verständlich bleibt und Musik ihre volle Wirkung entfalten kann – unabhängig von der Raumgröße.
Schallreflexion – wenn Schall zurückgeworfen wird
Unter Schallreflexion versteht man das Zurückwerfen einer Schallwelle von einer Oberfläche. Wie in der Optik gilt auch hier: Einfallswinkel = Reflexionswinkel. Trifft Schall auf eine harte Fläche, wird er reflektiert – oft so, dass der Eindruck einer „Spiegelschallquelle“ entsteht.
Reflexionen beeinflussen entscheidend, wie wir Räume akustisch wahrnehmen:
-
-
0–1 ms Verzögerung → Schallquelle und Reflexion werden als ein gemeinsames Signal gehört (Summenlokalisation).
-
1–50 ms (Sprache) / bis 80 ms (Musik) → der sogenannte Präzedenzeffekt sorgt dafür, dass der Direktschall dominiert.
-
> 50–80 ms → Reflexionen werden als Echo wahrgenommen.
-
Auch im Freien tritt Schallreflexion auf, z. B. durch den Boden. Die Überlagerung von direkter und reflektierter Welle kann zu Interferenzen führen – also zu Pegelverstärkungen oder -abschwächungen.
Schallreflexion ist somit ein zentrales Phänomen der Raum- und Bauakustik – sie kann den Klang verbessern oder stören, je nach Gestaltung der Flächen.
Schall – hörbare Schwingungen
Schall sind mechanische Schwingungen, die sich in Gasen, Flüssigkeiten oder festen Stoffen ausbreiten. Für den Menschen ist nur ein bestimmter Bereich hörbar: etwa 16 Hz bis 20.000 Hz. Mit zunehmendem Alter nimmt die Hörfähigkeit für hohe Töne deutlich ab.
-
-
Infraschall: unter 16 Hz – für uns unhörbar, von Tieren wie Walen oder Tigern genutzt.
-
Ultraschall: über 20.000 Hz – ebenfalls unhörbar, aber wichtig für Fledermäuse (Echolot) oder technische Anwendungen wie Sonografie.
-
Schall breitet sich in Form von Druckschwankungen aus: Moleküle werden verdichtet und verdünnt, wobei die Bewegung von einem Molekül auf das nächste übertragen wird. Abhängig vom Medium unterscheidet man Luftschall und Körperschall.
Schall ist also nicht nur die Grundlage unserer Kommunikation, sondern auch ein vielseitiges Naturphänomen – genutzt von Mensch, Tier und Technik.
Schallabsorption – wenn Materialien Schall „schlucken“
Unter Schallabsorption versteht man die Verringerung von Schallenergie, meist durch deren Umwandlung in Wärme. Einfach gesagt: Materialien „schlucken“ Schall statt ihn zurückzuwerfen.
-
-
Schallharte Materialien wie Beton, Mauerwerk, Gips oder Holz reflektieren Schall stark und absorbieren nur wenig.
-
Poröse Materialien wie Faserplatten aus PET-Recycling Filz, Mineralfaserplatten, Akustikschaum, Textilien oder dicke Teppiche sind besonders wirksam im Mittel- und Hochtonbereich – also genau im Sprachbereich.
-
Spezielle Konstruktionen (z. B. Holz- oder Blechplatten mit poröser Hinterfüllung) können auch tiefe Frequenzen gut absorbieren.
-
Für eine gute Raumakustik braucht es die richtige Kombination: Wand- und Deckenverkleidungen, Stellwände oder Lärmschirme verkürzen die Nachhallzeit und verbessern die Sprachverständlichkeit.
Die Wirksamkeit hängt vom Absorptionsgrad des Materials ab – dieser ist frequenzabhängig und wird nach Norm in Hallräumen gemessen.
Schallausbreitung – wie sich Schall bewegt
Eine Schallquelle ist ein Körper, der durch mechanische Schwingungen Schall erzeugt. Das können elastische Festkörper (z. B. Saiteninstrumente, Trommeln), Flüssigkeiten (plätscherndes Wasser, Strömungsgeräusche) oder Gase (z. B. die Luft in einem Blasinstrument) sein. Auch ein Schallempfänger wie das menschliche Ohr oder ein Mikrofon funktioniert durch Schwingungen – sie werden in biologische oder elektrische Signale umgesetzt.
Wichtig: Schall benötigt immer ein Medium (Luft, Wasser, feste Stoffe). In einem Vakuum breitet er sich nicht aus.
In Räumen hängt die Schallausbreitung stark von den Oberflächen ab:
-
-
Schallharte Flächen → reflektieren, erzeugen Nachhall und erhöhen den Schallpegel.
-
Schallabsorbierende Materialien → verkürzen die Nachhallzeit und reduzieren die Lautstärke.
-
Die Nachhallzeit ist entscheidend:
-
-
Kathedralen, Hallenbäder oder Fabrikhallen → lange Nachhallzeit, hallig und laut.
-
Räume mit Absorbern → kurze Nachhallzeit, klarere Akustik.
-
Besonders in kleinen Räumen treten Resonanzerscheinungen bei tiefen Frequenzen auf: An einem Platz ist der Ton extrem laut, nur wenige Meter weiter fast unhörbar. Solche Effekte lassen sich mit gezielten Maßnahmen wie Tieftonabsorbern oder elastischer Lagerung von Maschinen reduzieren.
Die Qualität der Raumakustik hängt also nicht nur von der Schallquelle, sondern auch von den Raumeigenschaften und eingesetzten Materialien ab.
Schallbrücken und Nebenwege – die versteckten Schwachstellen
Eine noch so gute Schalldämmung verliert an Wirkung, wenn der Schall nicht durch das Bauteil selbst, sondern über Nebenwege in den Nachbarraum gelangt. Solche Schallbrücken entstehen beispielsweise, wenn Schall eine Trennwand umgeht und über eine leichte Fassade oder angrenzende Bauteile weitergeleitet wird.
Da sich Nebenwege nie vollständig vermeiden lassen und ihre Berechnung komplex ist, gilt: Schon kleine Schwachstellen können die gesamte Dämmleistung erheblich mindern.
Deshalb ist eine ganzheitliche Planung der Bauakustik entscheidend – nur so lässt sich eine wirksame Schalldämmung sicherstellen.
Schalldämmung vs. Schalldämpfung
Die Begriffe Schalldämmung und Schalldämpfung sind klar voneinander zu unterscheiden:
– Schalldämmung (Bauakustik): verhindert, dass Geräusche von einem Raum in den anderen dringen. → Die effektivste Maßnahme, wenn man sich durch Lärm aus Nachbarräumen gestört fühlt.
– Schalldämpfung (Raumakustik): reduziert den Schall innerhalb eines Raumes, indem ein Teil der Schallenergie absorbiert wird. Dadurch wirkt die Lautstärke angenehmer, die Übertragung in Nachbarräume wird jedoch nur geringfügig reduziert.
Fazit: Für Lärmschutz zwischen Räumen ist die Schalldämmung entscheidend, während Schalldämpfung vor allem die Raumakustik und Sprachverständlichkeit verbessert.
Schalldruck – die physikalische Basis der Lautstärke
Der Schalldruck entsteht durch winzige Druckschwankungen der Luftmoleküle, die unser Ohr als Lautstärke wahrnimmt. Obwohl diese Schwankungen extrem klein sein können, reicht ihr Bereich von der Hörschwelle bei 0 dB SPL bis zur Schmerzgrenze bei etwa 130 dB SPL.
Zur Veranschaulichung einige Beispiele:
-
-
0 dB → Hörschwelle
-
10 dB → leises Flüstern
-
40 dB → Wellenrauschen
-
60 dB → Straßenlärm
-
100 dB → lautes Schreien
-
120 dB → Presslufthammer
-
130 dB → Schmerzgrenze
-
>150 dB → Alarmsirene, Raketentriebwerk
-
Da der Dynamikbereich des Schalldrucks enorm groß ist, wird er in Dezibel (dB SPL) angegeben. Wichtige Zusammenhänge:
-
-
+10 dB → doppelt so laut empfunden
-
+3 dB → entspricht der Addition zweier gleich starker Schallquellen
-
Verdoppelung der Entfernung → Schalldruck sinkt um ca. 6 dB
-
Schalldruck ist somit die Grundlage für alle Angaben zu Lautstärke, Schallpegeln und akustischer Wahrnehmung.
Schallpegel – hörbare Lautstärke in dB
Das menschliche Ohr kann einen enormen Bereich an Schalldruck verarbeiten – von der Hörschwelle bei 0,00002 Pa bis zur Schmerzgrenze bei etwa 20 Pa. Damit dieser riesige Bereich handhabbar wird, nutzt man den Schallpegel L, angegeben in Dezibel (dB) auf einer logarithmischen Skala:
-
-
0 dB → Hörschwelle
-
120 dB → Schmerzgrenze
-
So lassen sich die sechs Größenordnungen des Schalldrucks auf einen kompakten Wertebereich abbilden.
Wichtige Zusammenhänge:
-
-
+3 dB → Verdoppelung der Schallleistung (z. B. 2 gleich laute Quellen: 65 dB + 65 dB = 68 dB)
-
+6 dB → Verdoppelung des Schalldrucks
-
+10 dB → Verzehnfachung der Schallleistung
-
+20 dB → Verzehnfachung des Schalldrucks
-
Der Schallpegel ist damit die zentrale Größe, um Lautstärke messbar und vergleichbar darzustellen.
Schallwellen – die Grundlage des Hörens
Schallwellen sind Druckschwankungen in der Luft, die durch Schwingungen entstehen. Sie können auch in Flüssigkeiten oder festen Stoffen auftreten und breiten sich mit Schallgeschwindigkeit aus.
-
-
Wellenlänge und Frequenz:
-
Lange Wellen → tiefe Töne (niedrige Frequenz)
-
Kurze Wellen → hohe Töne (hohe Frequenz)
-
Unabhängig von der Frequenz breiten sich alle Töne gleich schnell aus.
-
-
Lautstärke und Tonhöhe:
-
Die Höhe der Schallwelle bestimmt den Schalldruckpegel (dB) → Lautstärke
-
Die Länge der Schallwelle bestimmt die Frequenz (Hz) → Tonhöhe
-
-
Wahrnehmung:
Schall wird erst dann zu Lärm, wenn er subjektiv als störend empfunden wird. Die Bewertung hängt nicht nur von Schallpegel und Spektrum ab, sondern auch von persönlichen Faktoren und der Situation. Deshalb nutzt man oft A-bewertete Pegel (dB(A)), die die Empfindlichkeit des menschlichen Gehörs berücksichtigen. -
Arten von Schallwellen:
-
Töne → regelmäßige Schwingung mit fester Frequenz (Sinuswelle, z. B. eine Tonleiter)
-
Klänge → mehrere Töne mit Vielfachen des Grundtons, inklusive Obertöne (geben Instrumenten ihre typische Klangfarbe)
-
Geräusche → unregelmäßige, chaotische Schwingungen (z. B. Rauschen, Knall)
-
-
Schallwellen sind die Basis von Sprache, Musik und Geräuschen – und damit der Schlüssel für unsere akustische Wahrnehmung.
Sprachverständlichkeit – klare Kommunikation ermöglichen
Die Sprachverständlichkeit beschreibt, wie gut Sprache beim Zuhörer ankommt – ob direkt vom Sprecher oder über eine elektroakustische Anlage.
-
-
Im Freifeld (ohne Reflexionen, Absorption oder Hindernisse) nimmt der Schalldruckpegel nur mit der Entfernung ab.
-
In Räumen überlagern sich Direktschall und Reflexionen zu einem diffusen Schallfeld, das die Verständlichkeit stark beeinflusst.
-
Da Sprachverständlichkeit nicht direkt messbar ist, wird sie mit speziellen Bewertungsverfahren beurteilt. Ein zentraler Faktor ist dabei die Nachhallzeit:
-
-
Zu lange Nachhallzeit → Sprache verschwimmt, Silben überlagern sich.
-
Zu kurze Nachhallzeit → Sprache klingt unnatürlich „trocken“.
-
Laut DIN 18041 und den Richtlinien der Schweizerischen Akustischen Gesellschaft (SGA) sind für gute Sprachverständlichkeit gezielte raumakustische Maßnahmen notwendig:
-
-
Absorber gleichmäßig im Raum verteilen
-
Decke teilweise schallhart (für nützliche Reflexionen ins Publikum)
-
Rückwand schallabsorbierend (zur Vermeidung von Echos)
-
Flatterechos durch punktuelle Absorption verhindern
-
Besondere Anforderungen je nach Raum:
-
-
Unterrichts-, Sitzungs- und Vortragsräume → sehr gute Verständlichkeit nötig
-
Großraumbüros → eher reduzierte Verständlichkeit erwünscht, um Ablenkung durch Nachbargespräche zu vermeiden
-
Banken & vertrauliche Gespräche → gezielt schlechte Verständlichkeit, um Diskretion zu sichern
-
Mit den richtigen Maßnahmen kann Sprachverständlichkeit entweder optimiert oder bewusst reduziert werden – je nach Nutzung des Raumes.